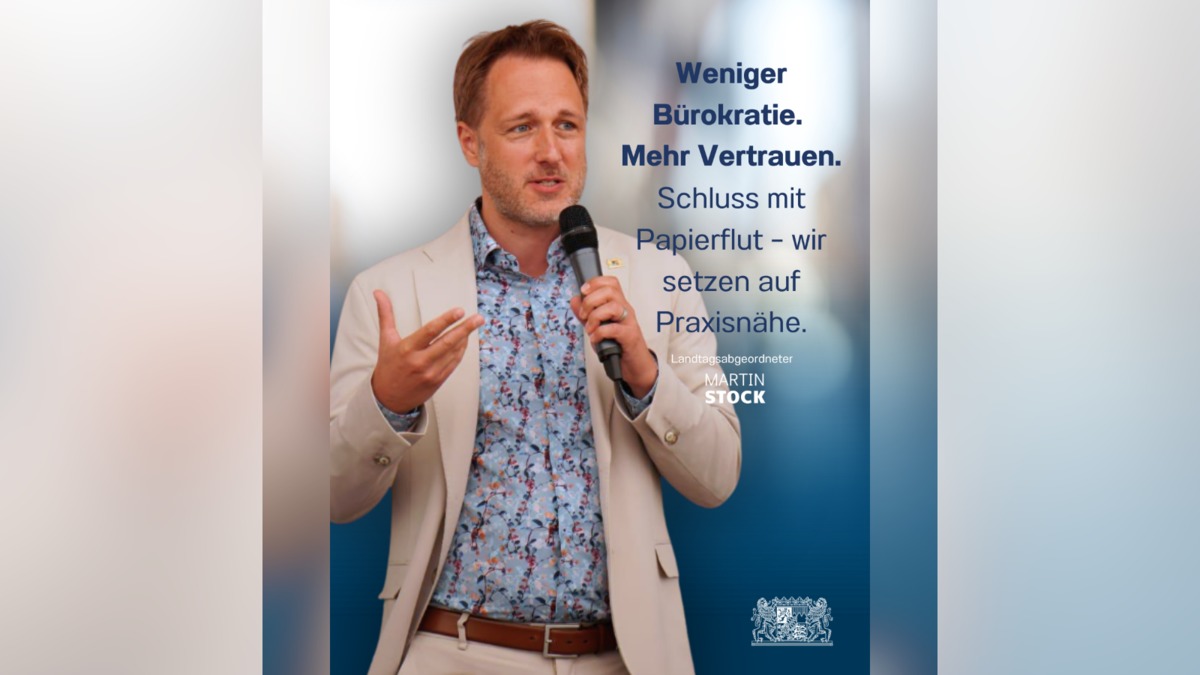Die Staatsregierung will das Leben der Menschen in Bayern einfacher machen und dies durch eine Reihe von Modernisierungsgesetzen erreichen, mit denen Stück für Stück das Landesrecht durchforstet wird und bürokratische Hindernisse abgebaut werden.Mit seiner Regierungserklärung vom 13. Juni 2024 hat Ministerpräsident Dr. Markus Söder das „Modernisierungs- und Beschleunigungsprogramm 2030“ vorgestellt. Ziel ist neuer Schwung und weniger Bürokratie, stattdessen mehr Eigenverantwortung der Bürger und Vertrauen.
Die Schwerpunkte des Dritten Modernisierungsgesetzes setzen die Entbürokratisierungs- und Deregulierungsbemühungen der Staatsregierung nahtlos fort. Im Wesentlichen werden folgende Änderungen vorgenommen:- Im Zuwendungsrecht sollen Verwendungsnachweise für Kleinförderungen bis 10.000 Euro entfallen, bei Kommunalförderungen sogar bis 100.000 Euro;
- beim Immissionsschutzrecht wird die sog. „Baumaschinenverordnung“ gestrichen, nachdem durch den technischen Fortschritt die Grenzwerte längst unterschritten wer den, und die Lärmaktionspläne der Gemeinden benötigen kein Einvernehmen der Regierungen mehr;
- Änderung bei der Feuerbeschau, die nur noch für Sonderbauten automatisch vorge schrieben wird und damit die Gemeinden und örtlichen Feuerwehren spürbar entlastet, ohne zugleich das Sicherheitsniveau abzusenken;
- im Baurecht werden weitere Vorhaben verfahrensfreigestellt, so der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Gebäude, die Errichtung kleinerer Gebäude ohne Aufent haltsmöglichkeit im Außenbereich und von Brennstoffzellenanlagen im Zusammenhang mit bestehenden Energieerzeugungsanlagen;
- Erhöhung der Schwellenwerte der Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) bei Betrieb und Errichtung von Beschneiungsanlagen (von 15 ha auf 20 ha, bei besonders geschützten Gebieten – z. B. Nationalpark, Naturschutzgebiet, Wasserschutzgebiet o.Ä. – von 7,5 ha auf 10 ha), Errichtung von Skipisten (erst ab 20 ha statt 10 ha, bei besonders geschützten Gebieten ab 10 ha statt 5 ha), bei Bau und Betrieb von Seilbahnen (zukünftig müssen die Merkmale Personenbeförderungskapazität und Luftlinienlänge zwischen der Tal- und der Bergstation kumulativ vorliegen und es wird zudem mit Blick auf die Luftlinienlänge bei Schleppliften und den übrigen Seilbahnen ein einheitlicher (erhöhter) Schwellenwert von 3000 m angesetzt) sowie der Inanspruchnahme von gesetzlich geschützten Biotopen zu intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (ab 10 ha statt bisher ab 1 ha).
Die neuen landesrechtlichen Schwellenwerte orientieren sich dabei an unserem Nachbarland Österreich – überall gelten die identischen europarechtlichen Vorgaben. Hierdurch wird eine spürbare Beschleunigung der betroffenen Verwaltungsverfahren ermöglicht und zugleich eine Überimplementierung von EU-Recht in Bayern verhindert.
Unsere Position
Dass wir Bürokratie abbauen und die Schwellenwerte an europäisches Niveau anpassen, ist ein richtiger und längst überfälliger Schritt. Es ist gut und richtig, dass Vorschriften beleuchtet werden, um bürokratische Vorgaben zu reduzieren. Wir entlasten Genehmigungsverfahren von entbehrlicher Bürokratie, ohne inhaltlich beim Naturschutz Abstriche zu machen. Wer glaubt, dass mehr Formulare mehr Umweltschutz bedeuten, liegt falsch. Es geht um Augenmaß und praxistaugliche Regeln – für Mensch, Natur und regionale Wirtschaft. Die großen Schutzgüter behalten wir dabei immer im Auge.
Vorteile für die Menschen in Bayern
Die CSU-Fraktion ist der festen Überzeugung, dass mit dem Dritten Modernisierungsgesetz ein wichtiger Schritt in die Zukunft gemacht wird – eine Zukunft, in der wir aus der Verpflichtung gegenüber kommenden Generationen den Naturschutz in Bayern in der regionalen Entwicklung fest verankern und weiterhin stärken wollen.Die Herausforderung liegt darin, verschiedene legitime Interessen in Einklang zu bringen: den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen wie die Lebensrealität der Menschen in den ländlichen Räumen, die auf Infrastruktur, Arbeitsplätze und touristische Angebote angewiesen sind. Bei der geplanten Entbürokratisierung geht es darum, Regelungen so zu gestalten, dass sie für Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar und für Behörden handhabbar sind, ohne materiell den Umwelt- oder Naturschutz zu schwächen.